- Forschung Fachbereich Sozialwesen, Hochschule RheinMain, Prof. Dr. Schütte-Bäumner
- Forschung Webseite Prof. Dr. Schütte-Bäumner Hochschule RheinMain Fachbereich Sozialwesen
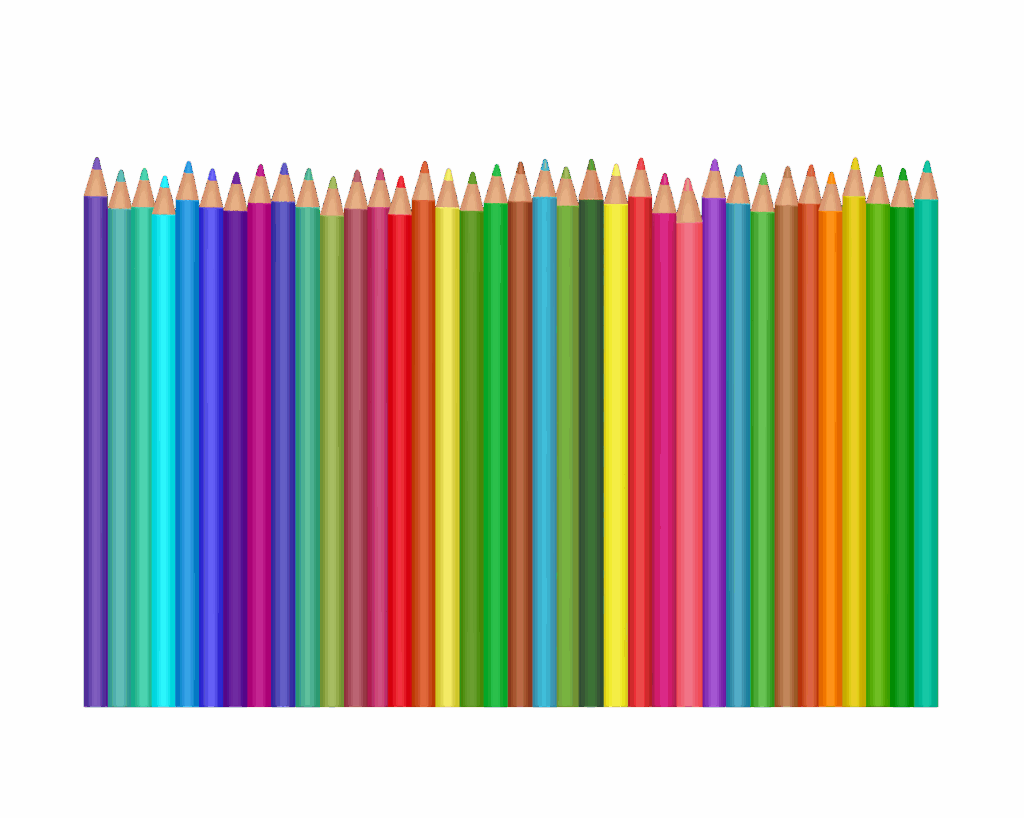
Netzwerk_HoPaWie – Netzwerkaktivitäten hospizlich-palliativer Versorgungsstrukturen in Wiesbaden
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Exploration der hospizlich-palliativen Versorgungsstrukturen und Netzwerkaktivitäten in Wiesbaden. Mittels Expert:innen-Interviews werden die Kooperationen zwischen den verschiedenen Netzwerkpartner:innen in den Blick genommen. Ergebnisse der Interviewauswertung sollen direkt durch den Theorie-Praxis-Transfer der Praxis im Sinne von Aus-, Fort- und Weiterbildung zugutekommen.
Start im ersten Quartal 2025.
Forschungsteam:
Laura Baronowsky, SHK (studentische Hilfkraft)
Lea Wagner B.A., wissenschaftliche Kooperationspartnerin
Prof. Dr. Christian Schütte-Bäumner, HSRM FBSW
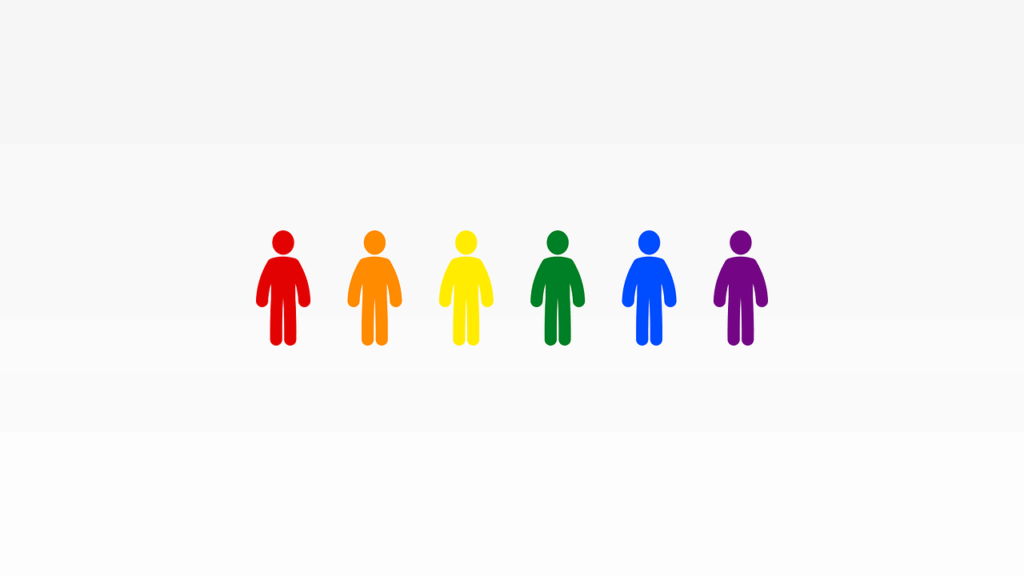
HoPaSoz – Hospiz- und Palliativversorgung im strukturschwachen ländlichen Sozialräumen
Forschungsteam:
Prof. Dr. Ingo Neupert und Prof. Dr. Christian Schütte-Bäumner
Anne Taubert, Christopher Southernwood
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 01.01.2023 bis zum 31.12.2024
Link zur HoPaSoz Forschungsprojektwebseite HSRM FBSW
Veröffentlichung: https://hlbrm.pur.hebis.de/xmlui/handle/123456789/300
Projektbeschreibung
Die medizinische, pflegerische und psychosoziale Versorgungssituation am Lebensende erfordert die verstärkte Inanspruchnahme von formellen und informellen Netzwerken sowie spezialisierte hospizlich-palliative Versorgungsstrukturen innerhalb des Sozialraums durch die Betroffenen und deren sozialen Umfeld. In Bezug auf die vorhandenen palliativen Versorgungsangebote lassen sich regional sehr große Unterschiede identifizieren. Hierbei weisen insbesondere ländliche Regionen ausgeprägte Versorgungslücken zwischen Versorgungsbedarfen der Bevölkerung und vorhande-nen Angeboten auf. Spezifische Bedingungen des strukturschwachen ländlichen Sozialraums sind u.a. der Rückgang von infrastrukturellen Ressourcen mit Auswirkungen auf die Gesundheit, man-gelnde Zugänge zu Gesundheitsversorgungsangebote in Quantität und Qualität sowie soziokultu-relle Aspekte des ländlichen Lebens.
Gesundheitliche Versorgung und insbesondere hospizlich-palliative Angebote flexibilisiert sich zu-nehmend in den Leistungssystematiken, über tradierte Sektorengrenzen hinweg und differenziert sich in Angeboten aus. Diese Entwicklung vollzieht sich in urbanen Räumen. Der Blickwinkel von strukturschwachen ländlichen Sozialräumen hinsichtlich der spezifischen Bedingungen, den zukünf-tigen Versorgungsbedarfen, aber auch den Ressourcen aus den besonderen Lebenslagen und Netzwerkstrukturen liegen im Fokus des Forschungsprojektes.
Zielsetzung des Projektes HoPaSoz ist es, die bestehenden Infrastrukturen und Rahmenbedingun-gen der hospizlichen und palliativen ambulanten, teilstationären sowie stationären Versorgungsan-gebote speziell für strukturschwache ländliche Sozialräume innerhalb Deutschlands am Beispiel von exemplarischen Regionen zu analysieren. Dabei liegt der Forschungsfokus auf drei Einflussebenen:
- Identifizierung von sozialrechtlichen Barrieren in der Leistungssystematik für Leistungserbrin-ger:innen und Leistungsempfänger:innen in der der Hospiz- und Palliativversorgung,
- Exemplarische Sozialraumanalyse zur hospizlich-palliativen Versorgungsstruktur in struktur-schwachen ländlichen Regionen und
- Netzwerkanalyse von innovativen Good-Practice Ansätzen aus strukturschwachen ländlichen Sozialräumen zur Identifizierung von Gelingensfaktoren von hospizlich-palliativen Versorgungs-strukturen.
Sozialpädagogisch orientierte Kinderpalliativversorgung (SOK) | Forschung HSRM
- Sozialpädagogisch orientierte Kinderpalliativversorgung (SOK) | Forschung HSRM
- Forschung an der Schnittstelle von Kinderpalliativmedizin und Sozialpädagogik
- Förderzeitraum: Forschungssemester Sommersemester 2018-Wintersemester 2018/2019
- Abstract: Die palliativ-hospizliche Versorgung von lebensbegrenzend erkrankten Heranwachsenden ist in spezifischer Weise mit Themenfeldern der Kinder- und Jugendhilfe konfrontiert. Dies ergibt sich aus dem Recht der Heranwachsenden auf Entwicklung, Partizipation und Inklusion. Sowohl die gesellschaftliche Teilhabe, die durch Therapieentscheidungen zusätzlich eingeschränkt werden kann als auch die Mitbestimmung im alltäglichen Behandlungsprozess sind hiervon berührt. Zwar fordert der Gesetzgeber die Leistungserbringer der professionellen Palliativversorgung auf, die „besonderen Belange von Kindern“ (§ 37 b SGB V) zu berücksichtigen. Inhaltlich bleibt diese Forderung jedoch unbestimmt. Ziel des Forschungsschwerpunktes SOK ist es „die besonderen Belange von Kindern“ vom Standpunkt der „Erziehungstatsache“ (Bernfeld 1973) durch die Inblicknahme des Sorgeverhältnisses zwischen Heranwachsenden und Sorgeberechtigten empirisch zu fundieren. Die Bedeutung des Erziehungs- und Sorgeverhältnisses im Kontext der palliativen Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird dafür in den Blick genommen. Konkret wird erarbeitet, wie sich die Erziehungs- und Sorgeverhältnisse für die versorgenden Fachkräfte als Gegenstand ihrer Arbeit darstellen. Die auf die soziale und pädagogische Dimension zielende Forschungsperspektive jener ‚besonderen Belange von Kindern‘ wird dabei mit der spezifischen, ambulant-aufsuchenden Struktur insbesondere der SAPV KJ verknüpft. Hier ist davon auszugehen, dass die familiäre und die professionelle Praxis bei der Versorgung in der häuslichen Umgebung stark miteinander verflochten sind und sich im Alltag wechselseitig involvieren. Die Fokussierung der Untersuchung auf das Verhältnis der (familiären) Erziehungs- und Sorgebeziehungen zur professionell-palliativen Versorgungspraxis bedeutet, die ‚besonderen Belange‘ im (familiären) Erziehungs- und Sorgeverhältnis zu verorten und dabei von der Praxis der Versorgung her zu untersuchen. Auf diese Weise wird einerseits grundlagentheoretisch das Feld der Kinderpalliativversorgung erziehungswissenschaftlich erschlossen. Andererseits ergeben sich hierdurch wesentliche Informationen und Hinweise für sozialpädagogisch ausgerichtete Interventionsformen, beispielsweise in den Bereichen der (psychosozialen) Beratung, Begleitung und Fallarbeit (Fallanalyse, Fallarbeit, Fallevaluation).
Kinder palliativ begleiten (KPB) | Forschung für die Praxis
- Forschung im Bereich spezialisierter ambulanter Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche, SAPV KJ
- Förderzeitraum: 01.09.2016 – [kostenneutrale Verlängerung] 16.10.2017
- Vortrag (2017) (gemeinsam mit Alexandra Zein): Erziehungsverhältnisse im Kontext palliativ begleiteter Kinder und ihrer Familien, 34. Empirie AG der DgfE, 07. und 08. Juli 2017, Bielefeld
- Abschlussbericht auf Anfrage
- Forschung für die Praxis Link
- Projekt im Rahmen der Forschung für die Praxis Link
Transdisziplinäre Professionalität im Bereich spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (TP|sapv) | BMBF
- Am 16.07.2012 konnte das Forschungsteam TP|sapv seine Arbeit aufnehmen, nachdem wir am 27.09.2011 erfolgreich einen Antrag auf Forschungsförderung im Rahmen des BMBF-Förderprogramm „Forschung an Fachhochschulen“ hier: Ausschreibung der 4. Förderrunde „Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter“ (SILQUA-FH) gestellt haben. Das Forschungsteam setzt sich folgendermaßen zusammen:
- Prof. Dr. Christian Schütte-Bäumner, koordinierende Gesamtleitung und Leitung Projektstandort Wiesbaden
- Prof. Dr. Michael May, Wiesbaden
- Dipl. Päd. Falko Müller, Wiesbaden, heute Universität Siegen
- Prof. Dr. Ulrike Schulze, Leitung Projektstandort Frankfurt
- Dorothée Becker, Krankenschwester, MAS, Frankfurt Würdezentrum Link
- Assoziiertes Mitglied Dr. Ingmar Hornke, Frankfurt Würdezentrum Link
- Praxispartner Forschung Link
- Webseite tp-sapv.de Link
- Beiträge zum Forschungsprojekt
- Qualitative Forschung im Bereich Palliative Care, Verlag B.Budrich, FlyerPresse Link
- Keine Schmerzen auf dem letzten Weg. Palliativteams stellen medizinische Betreuung Schwerstkranker sicher, in: Senioren Zeitschrift, SZ 3, 2012, S. 28-29 /: sz_2012-3-28 Info hier
- Stadt Frankfurt unterstützt Forschungsvorhaben zur Palliativversorgung, in: Senioren Zeitschrift, SZ 3, 2012 Link
- Fachliche Grenzen überwinden (Falko Müller), in: Frankfurter Rundschau, Forschung für die Praxis, 20.12.2012 Link
- Poster Die „unsichtbare“ psychosoziale Arbeit an den häuslichen Voraussetzungen der SAPV (Schütte-Bäumner, Müller, May), 10. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und der 13. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung, 24. bis 27. Juni 2014, Düsseldorf Link
- Poster Transdisziplinarität|Transprofessionalität in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Münster, DVSG-Bundeskongress Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 2013 Link
- Poster TP|sapv: Perspektiven in Mitte: 9. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, 12.–15. September 2012 (bcc Berliner Congress Center | Berlin) Link
- Runder Tisch Palliativversorgung und Hospizarbeit MTK, Landratsamt in Hofheim, Main-Taunus-Kreis, der Kreisausschuss, Gesundheitsamt, Hofheim, August 2012: Vortragsskript auf Anfrage